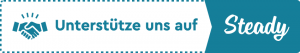Der Stadtgarten zeigt sein neues Gesicht – unter diesem Titel luden Theater und Ordnungsdezernat jüngst zum Pressetermin. Um mehr Sicherheit sollte es gehen und um mehr Kultur. Wie passt das zusammen?
U-Bahn, Junkies, Obdachlose – ist der Stadtgarten ein Angstraum?

Zunächst mal zum alten Gesicht: Stadtgarten, das bedeutet U-Bahn-Knotenpunkt. Hier kommt man an, wenn man in die City will. Hier gibt es Baustellen und Zäune, Hecken und schöne Blumenbeete. Eine Skaterampe, die gut angenommen wird. Menschen, die zur Bahn hasten und Menschen, die hier ein Bier trinken oder auch mehrere. Einer sucht gerade einen Platz, um die Flüssigkeit wieder los zu werden. Was soll man machen?
Ein Sicherheitsdienst patroulliert. Auch Obdachlose und Junkies haben hier einen Ort, sie sind Teil des Stadtbilds. Eine Situation, die sich mit Corona „verschärft“ hat, erklärt Ordnungsdezernent Norbert Dahmen.
Er meint damit die gestiegene Anzahl von Drogenabhängigen und Wohnungslosen in der Innenstadt – Menschen, denen während der Pandemie der Zugang zu Schutzräumen wie zum Beispiel dem Drogenkonsumraum nicht möglich war. Es gab Beschwerden vom City-Ring, aber auch von Theaterbesucher:innen, die ungern mit der Bahn zur Vorstellung an- bzw. abreisen. Im Dunkeln durch den kleinen Park zurück zur U-Bahn? Unangenehm. Der Stadtgarten – ein Angstraum?
„Es geht nicht um Kontrolle, aber Stadtgarten soll Spaß machen“

Unabhängig vom tatsächlichem Aufkommen und der Art der Straftaten sprechen Stadtplaner:innen immer dann von Angsträumen, wenn bei den Nutzer:innen eines Ortes das Gefühl der Unsicherheit dominiert. Unterführungen, dunkle Ecken – wer sich dort ängstigt und wie sehr, ist subjektiv, aber dennoch ernst zu nehmen.
Viele Städte beschäftigen sich mit dem Thema und die Konzepte, wie Abhilfe geschaffen werden kann, ähneln sich. In Dortmund kombiniert Dahmen verschiedene Ansätze, um „das neue Gesicht des Stadtgartens“ zu gestalten. So brachte beispielsweise der Rückschnitt der Hecken mehr Übersicht und es wurden neue und stärkere Lichtanlagen installiert. Aber: „Wir wollten das Thema Sicherheit ganz neu anpacken“, erklärt Dahmen.
Es gehe ihm nicht nur um Kontrolle, sondern „Stadtgarten soll Spaß machen“. Also: Theater! Dahmen verdankt die Idee seinem Büroleiter – der hat früher einmal Theaterwissenschaften studiert – und tatsächlich kam der Vorschlag den Stadtgarten mit Theater zu beleben bei Tobias Ehinger gut an. Für den Theaterdirektor ist die Idee eine schöne Möglichkeit, das Theater in der Stadt sichtbar zu machen und zur Entwicklung des Umfelds beizutragen.
Theater als ordnungspolitisches Instrument? Warum nicht!

Die Kritik der Theaterbesucher:innen ist auch Ehinger bekannt und in der Tiefgarage finden sich häufig Spritzen und Fäkalien.
„Dortmund soll schöner werden und sicherer“, findet Ehinger. Theater als ordnungspolitisches Instrument, dagegen hat er offenbar nichts. Die Kunst soll überraschen, neue Menschen an den Ort bringen und zur Veränderung der Publikumsstruktur im Stadtgarten beitragen. Denn „wenn Sie nicht wissen, was demnächst passiert, dann können Sie auch nichts planen, nichts Verbotenes zum Beispiel“, berichtet Ehinger.
Vermutlich hat er recht. Drogenhandel oder -konsum, Rausch ausschlafen – das ist schwieriger an Orten, die belebt sind. Aber was passiert dann? Die Bedürfnisse bleiben schließlich bestehen und die Menschen können sich ja nicht in Luft auflösen. Weder Ehinger noch Dahmen nehmen das Wort „Verdrängung“ in den Mund. Sie wünschen sich vielmehr „Durchmischung“ und eine „schönere Atmosphäre“.
Doch Skepsis ist angebracht, denn Kultur ist vielerorts bereits eine Methode geworden, Bettler:innen, Drogenkranke und Obdachlose zu vertreiben. Musikbeschallung an Bahnhöfen in Leipzig, Hamburg, Stuttgart oder auch Berlin ist erprobt – die Folge: Verdrängung der unerwünschten Klientel auf andere Plätze.
Der Mehmet-Kubaşık-Platz – oder wie es besser nicht sein sollte.

In ihren Erklärungen geht es den Initiator:innen immer um ein schöneres Ambiente und den Schutz der Reisenden, Anwohner:innen, Konsument:innen etc. Doch das ist schwer zu glauben, wenn die Konzepte eigentlich nur aus Dauerbeschallung bestehen oder – wie am Bahnhof Stuttgart – sogar die ganze Nacht das selbe Stück in Dauerschleife läuft.
Was macht Dortmund anders? Auch der Mehmet-Kubaşık-Platz in der Dortmunder Nordstadt ist Teil des „Aktionsplans City” und auch hier klang es in der Presse-Info Anfang Februar erstmal gut: Der Platz soll zu „Dortmunds erstem klingenden Platz“ werden. Solist:innen und Ensembles der Musikschule werden zu hören sein, junge Musiker:innen sollen eine Bühne bekommen.
Doch ein Besuch vor Ort macht ratlos. Immerhin keine Dauerbeschallung, aber wann und wie lange erklingt denn die Musik? Wo sind vor Ort Hinweise, was wir hören und von wem? Live-Konzerte bisher Fehlanzeige. Wenn hier wirklich durch Musik „die Lebens- und Aufenthaltsqualität” der Anwohner:innen gesteigert werden soll, ist noch einiges zu tun.
Da funktioniert die Idee im Stadtgarten schon besser. Das Programm ist niedrigschwellig, braucht keine Erläuterungen und ist damit nah an allen Menschen. Und es ist ein kurzweiliges Angebot, das einem die Chance lässt zu reagieren, aber auch – und das ist mindestens ebenso wichtig – es zu ignorieren.
Kultur und Sicherheit – eine schwierige Balance, aber auch Chance

Die Theatergruppe Kamaduka weiß von all diesen Debatten nichts. Die drei Schauspieler kommen aus Berlin, kennen den Stadtgarten gar nicht und haben sich einfach nur über die Chance gefreut, hier aufzutreten.
Die Konfrontation mit allen möglichen Menschen im öffentlichen Raum ist ihr tägliches Brot und sie haben keinerlei Berührungsängste. Sie glauben an die Kraft der Bilder, ihre Geschichte und sind es gewohnt auf alle zuzugehen. Ihr Ziel: ein Lächeln in die Gesichter zaubern.
An diesem Nachmittag erscheinen sie als „Die weißen Gentleman“, zeigen „Die tanzenden Fische“ und verkleiden sich als „Die Argonauten“ – ein weißes Schiff, das im Stadtgarten das Glück sucht. Die trinkfreudige Runde unter den Arkaden macht Selfies und wähnt sich im „Fluch der Karibik.“ Ihr Fazit: coole Aktion.
Das findet auch eine Passantin, die extra in den Stadtgarten gekommen ist, weil sie im Radio von der Aktion gehört hat. Sie liebt das Microfestival und wünscht sich mehr solcher Aktionen. Hat sie Angst im Stadtgarten? „Nein, das sind arme Menschen. Das gehört alles zum Leben.“ Da blitzt es kurz auf, das Miteinander. Vielleicht ist es ja doch möglich? Vielleicht geht der Plan „Sicherheit durch Kultur” auf und schließt niemanden aus? Es wird sich zeigen – die Fortsetzung des Experiments ist für Frühjahr 2023 geplant.
Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de:
Junge Talente der Musikschule Dortmund sollen den„Mehmet-Kubaşık-Platz“ mit Musik beleben
Kritik an Verwaltung: „Die geplante Beleuchtung hat den Charme eines Gefängnishofes“
Am Mehmet-Kubaşık-Platz soll die neue Stadtteilbibliothek für die Nordstadt entstehen
Der Beitrag Aktionsplan „Plätze in der City“: Mit Kultur gegen Drogenmissbrauch und Obdachlosigkeit? erschien zuerst auf Nordstadtblogger.